Das Internet hören und fühlen
geschrieben von Niki Slawinski (2005)
GS/GO-Modell angewendet auf die Internetnutzung der Blinden
Die Nutzungsmöglichkeiten und damit auch das Potenzial des Internets habe ich in den vorherigen Kapiteln eingehend erläutert. Ich wende nun das im vorigen Kapitel (1.3) erweiterte GS/GO-Modell auf die Internetnutzung Blinder an und strukturiere damit die bisher aufgeführten Aspekte systematisch. In diesem erweiterten Modell füge ich neue Begriffe hinzu und ergänze bestehende Formulierungen durch nähere Erläuterungen.
Die Spezifikationen des von mir erweiterten GS/GO-Modells erläutere ich im Folgenden. Wenn wir uns das Kapitel (2.2) über die Sonderstellung der Blinden in unserer Gesellschaft in Erinnerung rufen, lassen sich die sozialen und psychologischen Ursprünge der gegenwärtigen Erwartungen und Bewertungen des Internets von Blinden leicht erklären. Das zentrale Ziel der Blinden ist es, vollständig integriert in unserer Gesellschaft zu leben und "normale" soziale Kontakte, auch zu Sehenden, zu haben. Um dies zu erreichen, müssen und wollen sie die größtmögliche Unabhängigkeit von Sehenden erhalten und ihr Leben möglichst eigenständig führen. Das Internet stellt ein wichtiges Hilfsmittel für das Erreichen dieser Ziele dar.
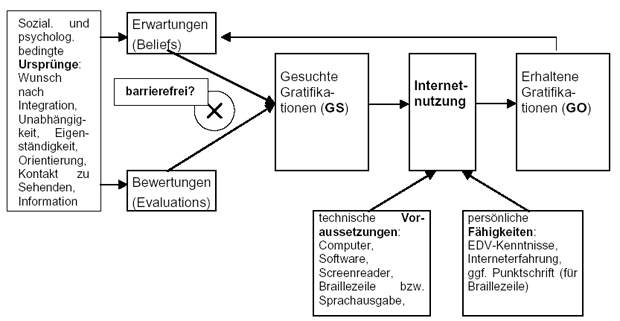
Wie in Kapitel "Erweitertes GS/GO-Modell mit Blick auf das Internet" vermutet, sind für die Internetnutzung die Punkte "technische Voraussetzungen" und "persönliche Fähigkeiten" relevant. Die technischen Voraussetzungen für Blinde, um das Internet nutzen zu können, sind der Computer, Screenreader ("Brückensoftware"), die Braillezeile bzw. Sprachausgabe und ggf. weitere Hard- und Software. Eine Hürde stellen die persönlichen Fähigkeiten dar. Wie bei keinem anderen Medium bzw. Blindenhilfsmittel, verlangt die Internetnutzung dem blinden Nutzer spezielle Kenntnisse ab. Die Möglichkeiten der Internetnutzung hängen aber auch von der Gestaltung des Medienangebots X ab, also davon, ob es barrierefrei gestaltet ist. Die Frage, wann ein Internetangebot barrierefrei ist, wurde in der Diskussion anfangs unterschiedlich diskutiert (siehe Kapitel "Die Bewegung zum barrierefreien Webdesign"). Nach gegenwärtigen Expertenmeinungen scheint mit der Barrierefreie Informationstechnik-Verordnung (BITV) die Frage verbindlich beantwortet zu werden.
Der Bereich der gesuchten und erhaltenen Gratifikationen wird in der Literatur unbefriedigend behandelt. In Nebensätzen werden einige dieser Gratifikationen genannt, so dass man davon ausgehen kann, dass diese von Blinden gesucht werden. Allerdings lassen sich kaum Erfahrungsberichte finden, die einen guten Einblick verschaffen, welche Gratifikationen bei blinden Schülern im Alltag eine wirklich relevante Rolle spielen. Die auftretenden Probleme werden ausführlich beschrieben, aber nicht, die Möglichkeiten, welche Blinde nutzen können. Des Weiteren bleibt ungeklärt inwieweit das Erhalten der Gratifikationen tatsächlich von technischen Voraussetzungen, persönlichen Fähigkeiten und zu guter Letzt von der Gestaltung des Medienangebots abhängig ist. Um die Relation dieser Aspekte und vor allem die tatsächliche Bedeutung der Barrierefreie Informationstechnik-Verordnung beurteilen zu können, führe ich eine empirische Untersuchung durch, welche ich im Kapitel "Qualitative Studie" erläutere.
Der Beitrag Das Internet hören und fühlen besteht aus folgenden einzelnen Webseiten:
- Einleitung
- Der Nutzenansatz bezogen auf das Internet
- Die Kommunikationssituation blinder Schüler
- Formen von Sehschädigungen
- Die Sonderstellung Blinder in unserer Gesellschaft
- Die Entwicklung der Kommunikationshilfsmittel für Blinde
- GS/GO-Modell angewendet auf die Internetnutzung der Blinden
- Vorgaben für barrierefreies Webdesign (BITV)
- Qualitative Studie
- Die Wahl qualitativer Forschungsmethoden
- Gruppeninterviews
- Gruppendiskussionen
- Gesamtanalyse
- Fazit
- Glossar
- Literaturverzeichnis
- Kontakt mit Niki Slawinski